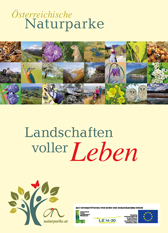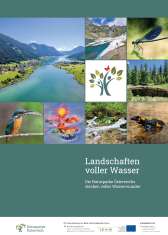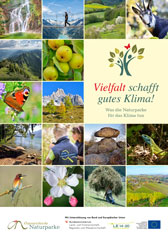Schutz des Wassers
Zum Schutz unserer Landschaften voller Wasser setzen die Naturparke etwa Renaturierungsmaßnahmen um oder führen spezielle Artenschutzprojekte und Klimawandelanpassungsmaßnahmen durch. Ein besonderer Fokus wird auch darauf gelegt, eine Balance zwischen Naturschutz und nachhaltiger Nutzung durch den Menschen zu fördern.
Moor-Renaturierung

Moore sind sensible und vielfältige Lebensräume, wertvolle CO2-Speicher und in vielen Naturparken Österreichs auch ein wichtiger Arbeitsbereich.
Im Naturpark Almenland wurde etwa das Latschenhochmoor Teichalm renaturiert und der Moorlehrpfad erneuert, um die Faszination Moor vielen Besucher:innen näher zu bringen. Die Naturparke Hochmoor Schrems und Nagelfluhkette renaturieren mittels Spundwänden und Durchforstungen mehrere Hektar an Moorfläche.
Auch weitere Naturparke sind in diesem Bereich aktiv und Teil des bislang größten Moorprojekts in Österreich: Für AMooRe werden bis 2033 rund 1400 Hektar Fläche in 40 Moorgebieten naturschutzfachlich optimiert. Auch der Wissensaufbau und -austausch spielt dabei eine wesentliche Rolle.
Ein harmonisches Miteinander

Wasser ist in Naturparken ein Lebens- und Erlebnisraum. Ob klare Gebirgsbäche, idyllische Seen oder mystische Moore – sie bieten sowohl Erholung als auch Abenteuer. Doch gerade diese besonderen Orte sind oft auch sensible Bereiche für Tiere und Pflanzen, die hier ihren Lebensraum haben. Um den Erholungswert für Gäste zu erhalten und gleichzeitig die fragile Natur zu schützen, ist daher eine durchdachte und gut geplante Besucher:innenlenkung von größter Bedeutung.
Der Schutz beginnt bereits bei der Planung. Wer auf öffentliche Verkehrsmittel setzt oder bewusst Parkplätze nutzt, die in strategisch sinnvollen Bereichen – etwa in der Nähe offizieller Badeplätze oder Einstiegspunkte für Wassersport – liegen, trägt aktiv dazu bei, sensible Zonen zu entlasten. Das bedeutet: weniger Störungen für Tiere, weniger Trittschäden an Ufern und eine nachhaltigere Erholung für alle.
In den Naturparken gibt es viele wunderbare Plätze zu entdecken. Um die heimische Fauna und Flora nicht zu stören, sollte man in Naturparken darauf achten, nur jene Spots aufzusuchen, die auch dafür vorgesehen sind. Du bist unsicher, ob ein „Geheimtipp“ wirklich besucht werden sollte? Frag einfach im Naturpark nach! Vielleicht gibt es sogar eine geführte Tour, bei der du noch mehr über die faszinierende Natur erfährst.
Wichtig ist auch, sich an markierte Wanderwege zu halten. Diese sind durchdacht und leiten Gäste durch die schönsten Landschaften voller Wasser, ohne die Tier- und Pflanzenwelt zu stören. Führt ein Weg also nicht zu einer Schotterbank, bei der man sich gerne kurz abkühlen würde, gibt es dafür vielleicht einen guten Grund. Möglicherweise brütet da etwa ein Flussuferläufer, den man verjagen oder gar versehentlich dessen Nest zerstören würde.
Jedes Wasserjuwel weist seine Besonderheiten auf. Deswegen informieren Naturparke ihre Gäste gerne bereits bei der Planung und natürlich auch vor Ort über wichtige Verhaltensregeln. Die Naturparke Österreichs laden dich ein, die Schönheit der Gewässer zu genießen – mit Achtsamkeit und Respekt. So schützen wir unsere Landschaft voller Leben, für uns und kommende Generationen.
Schutz spezieller Tierarten

Flussperlmuschel, Steinkrebs oder Edelkrebs – die österreichischen Naturparke schützen die heimischen, aber selten gewordenen Bewohner unserer Flüsse. So sind in vielen Naturparken Projekte im Gange, die den Erhalt heimischer Wasserlebewesen sichern sollen.
Der Edelkrebs oder Europäische Flusskrebs (Astacus astacus) ist die größte unter den in Europa heimischen Krebsarten und war im 19. Jahrhundert noch weit verbreitet. Durch die Einschleppung von amerikanischen Krebsarten, die mit der sogenannten Krebspest infiziert waren, wurden die Edelkrebsbestände in Europa fast ausgerottet. Unsere Naturparke setzen sich aktiv ein, um den Bestand der heimischen Krebse zu erhalten und zu fördern. So wurde im Naturpark Attersee-Traunsee eine Krebssperre errichtet, um die Einwanderung von amerikanischen Signalkrebsen zu unterbinden. Der Naturpark Ybbstal fördert die Steinkrebse durch eine Ansiedelung in Bächen, die geeignete Lebensräume bieten. So soll langfristig eine stabile Population aufgebaut werden. Auch der Naturpark Weissensee engagiert sich für den Schutz der heimischen Krebse und erforscht in einem mehrjährigen Projekt die Kamberund Edelkrebse im Weissensee, um ihnen langfristig gute Bedingungen zu schaffen.
Im Naturpark Mühlviertel steht die Flussperlmuschel im Fokus des Artenschutzes. Sie bevorzugt kalkarme, sauerstoffreiche, nährstoffarme und kühle Gewässer mit hohem Gehalt an schwer abbaubaren Huminsäuren. In Österreich ist sie bereits vom Aussterben bedroht. Wichtige Aktivitäten zu ihrem Schutz sind einerseits die Nachzucht und andererseits die Schaffung von Flussbereichen, die den hohen Ansprüchen der Muschel gerecht werden. Um gute Lebensraumbedingungen zu schaffen, werden etwa jährliche Räumungen in gewissen Flussabschnitten vorgenommen, um die Ansammlung von Feinsediment zu verhindern.
Auch für den Eisvogel wird in den Naturparken Österreichs einiges getan, wie in den Naturparken Raab und Nagelfluhkette. So ist die Wiederherstellung von natürlichen Abbruchkanten an Flussufern eine wichtige Maßnahme, da er hier seine Bruthöhlen baut. Die Anlage von ruhigen Flachwasserzonen sorgt für eine sichere Nahrungsquelle, da er auf langsam fließende, fischreiche Gewässer angewiesen ist.
Das sind nur ein paar Beispiele für die engagierte und erfolgreiche Arbeit der Naturparke zum Schutz unserer heimischen Artenvielfalt.
Renaturierung des RißbachsNaturpark Karwendel

Der Rißbach weist im Tiroler Oberlauf viele Charakteristika eines alpinen Wildflusses auf. Er wurde streckenweise mit dem Ziel des Hochwasserschutzes verbaut. Aus einem ursprünglich verzweigten Fluss wurde ein gestreckter künstlicher Flusslauf. Dadurch wurden Abschnitte mit wertvoller Flora und Fauna von der natürlichen Flussdynamik abgeschnitten. Der Naturpark Karwendel widmete sich der Wiederherstellung des ursprünglichen Flusstyps, indem die Verbauungen entfernt wurden. Der Rißbach erhielt mehr Raum. Somit wurde ein natürlicher Ausdehnungsbereich im Falle eines Hochwassers geschaffen. Auch die letzten Abschnitte sollen noch renaturiert werden, um dem Fluss seine ursprüngliche Weitläufigkeit zurückzugegeben.
Neophytenmanagement

Invasive Neophyten, also nicht heimische Pflanzen, die Schäden verursachen können, siedeln sich häufig auch in Gewässernähe an. Dazu zählen etwa das Drüsige Springkraut, der Staudenknöterich oder die Riesen-Goldrute. Diese prägen immer augenscheinlicher die heimische Landschaft und stellen somit die Landwirtschaft und den Naturschutz vor große Herausforderungen.
Invasive Pflanzen verdrängen die heimischen Arten und können damit auch zu einer Veränderung der Lebensräume beitragen. Das erfolgt einerseits aufgrund ihrer starken Wüchsigkeit und Widerstandsfähigkeit, andererseits aber auch durch besondere Verbreitungsmechanismen. So kann das Springkraut seine Samen mehrere Meter weit schleudern.
Viele Anstrengungen, diese Arten wieder komplett loszuwerden, sind oft wenig aussichtsreich. Deshalb braucht es zum Schutz von gefährdeten heimischen Arten spezielle Pflegemaßnahmen.
Die Naturparke engagieren sich hier gemeinsam mit der regionalen Bevölkerung: in enger Zusammenarbeit mit Gemeinden, der Berg- und Naturwacht und Freiwilligen wird durch spezielle Maßnahmen das Aufkommen von Neophyten verhindert. Auch Naturpark-Schulen setzen bereits Aktionen zu diesem Thema um.